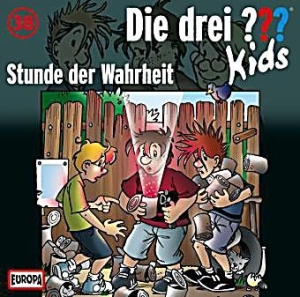Sind Krankheitsursachen bekannt, können Diagnose und Therapie verbessert werden. Foto: Universitätsklinikum Heidelberg
Sind Krankheitsursachen bekannt, können Diagnose und Therapie verbessert werden. Foto: Universitätsklinikum HeidelbergNeuherberg & Heidelberg 15. Juli 2016. Wissenschaftler des Helmholtz Zentrums München, der... Kommen Kinder mit seltenen angeborenen Organschäden, Gedeih- und Entwicklungsstörungen zur Welt, bleibt die Ursache häufig ungeklärt – eine zielgerichtete Therapie ist so kaum möglich. Nun haben Forscher die genetische Ursache für eine solche seltene Erkrankung bei drei Kindern mit schweren Symptomen entdeckt. In der Arbeitsgruppe von Dr. Holger Prokisch vom Institut für Humangenetik am Helmholtz Zentrum München und der TUM wurden alle Abschnitte der Patienten-DNA, die Informationen für die Herstellung von Proteinen beinhalten sequenziert. Genetische Analysen identifizierten Veränderungen im genetischen Bauplan für ein bestimmtes Enzym (Isoleucyl-tRNA-Synthetase, IARS), das in der Eiweißproduktion des Körpers unverzichtbar ist. Das Enzym, das dadurch einen Großteil seiner Funktion einbüßt, ist bisher noch nicht mit angeborenen Erkrankungen beim Menschen in Verbindung gebracht worden. Wohl aber bei Rindern: Einer in Japan häufigen Gedeihstörung bei Kälbern liegt ebenfalls dieser Defekt zugrunde. Welche molekularen Mechanismen in Folge zu Symptomen wie eingeschränktem Wachstum, Hirn- und Leberschäden führen, ist noch nicht verstanden. Eine Behandlungsmöglichkeit, die einige der Symptome lindert, gibt es bereits: Bei dem bislang einzigen bekannten deutschen Patienten, der seit 2000 am Universitätsklinikum Heidelberg betreut wird, fand das Ärzteteam um Professor Dr. Georg F. Hoffmann, Geschäftsführender Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin und Leiter des Zentrums für Seltene Erkrankungen Heidelberg, einen gravierenden Zinkmangel. Nach Ausgleich des Mangels nahm das damals siebenjährige Kind schlagartig zu und entwickelte sich ab sofort deutlich besser. „Zwar gibt es keine Therapie, die die genetische Veränderung ausgleichen kann. Trotzdem können zukünftig betroffene Kinder von diesem Wissen profitieren: Zeigt sich im Test ein IARS-Defekt, kann man früh mit Zink behandeln und möglicherweise einigen Schäden vorbeugen“, so der Experte für seltene, angeborene Erkrankungen. Neben dem mittlerweile 20jährigen Heidelberger Patienten wurden durch eine internationale Kooperation mit Partnern in Österreich und Japan bisher zwei weitere Kinder mit IARS-Defekt gefunden. Der österreichische Patient ist aktuell 4 Jahre alt und wird nun ebenfalls mit Zink behandelt. Die Forschungsergebnisse sind aktuell im American Journal of Human Genetics erschienen.
Genetische Veränderung blockiert Produktion von Eiweißen in den Zellen
Das Enzym IARS gehört zur elementaren Grundausstattung bei Tieren, Pflanzen und Pilzen. Es sorgt dafür, dass bei der Eiweißproduktion in den Zellen ein wichtiger Baustein, die Aminosäure Isoleucin, stets verfügbar ist. Dazu bindet IARS Isoleucin an ein Transportmolekül (tRNA), mit dessen Hilfe es exakt an der dafür vorgesehenen Stelle in das neue Eiweiß eingebaut wird. „IARS wird in jeder Zelle, in jedem Organ benötigt. Ein IARS-Defekt stört daher die Zellfunktion im gesamten Körper, verursacht Gewebe- und Organschäden“, sagt Seniorautor und Projektkoordinator Dr. Christian Staufner, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin Heidelberg. Um das Krankheitsbild besser zu verstehen, untersuchten die Heidelberger Wissenschaftler gemeinsam mit der Arbeitsgruppe um Dr. Holger Prokisch die Folgen eines IARS-Defektes in Hefekulturen und auch bei Zebrafischen, wo sie ähnliche Effekte beobachteten. Auch bei Säugetieren gibt es ein Modell für diese Erkrankung: In Japan verursachen IARS-Defekte bei Rindern der Rasse „Japanese Black Cattle“ das sogenannte „Weak Calf Syndrom“ und sind ein großes Problem der Viehwirtschaft. Rund die Hälfte der Kälber mit diesem Defekt stirbt schon vor der Geburt, die übrigen kommen unterentwickelt zur Welt, sind schwach, krankheitsanfällig und bleiben im Wachstum zurück. Der bei Menschen festgestellte Zinkmangel tritt allerdings bei den Kälbern nicht auf. „Wie IARS-Defekt und Zinkmangel zusammenhängen, bleibt noch zu klären, vor allem da die Gabe von Zink die bisher einzige Möglichkeit ist, wenigstens bei einzelnen Patienten die Symptome abzumildern“, so Staufner.In Aufklärung genetischer Ursachen des akuten Leberversagend führend
Der Fund der genetischen Veränderung reiht sich ein in die Suche der Arbeitsgruppen aus Heidelberg und München nach genetischen Ursachen von ungeklärtem akutem Leberversagen bei Kleinkindern. Akutes Leberversagen bei Kindern ist selten, aber lebensgefährlich. Es tritt meist plötzlich zum Beispiel im Zuge eines fiebrigen Infektes auf. Bei der Hälfte der Patienten lässt sich die Ursache nicht klären. Das Wissen um die Ursachen des akuten Leberversagens kann dazu beitragen, den Krankheitsverlauf besser einschätzen, gezielte Therapien und Diagnoseverfahren entwickeln sowie die Eltern besser beraten zu können.
Bereits 2015 identifizierte das Team bei Erbgutanalysen betroffener Kinder und ihrer Eltern eine andere genetische Veränderung, die mit dem Auftreten des Leberversagens zusammenhängt. Diese Veränderung betrifft das Protein NBAS, das eine wichtige Rolle beim Stofftransport innerhalb der Zelle spielt. Die beiden Kooperationspartner in Heidelberg und München nehmen mittlerweile bei der Aufklärung genetisch bedingter Lebererkrankungen im Kindesalter international eine Vorreiterrolle ein. Inzwischen konnten mehr als 40 Patienten mit NBAS-Defekt identifiziert werden, und auch hier entwickelten die Kooperationspartner eine hilfreiche Therapie. Aktuell werden alle Kinder in Deutschland, die an einem unerklärten Leberversagen leiden, in Heidelberg gemeldet.
Weitere Informationen:
Die Forschungsarbeit ist ein internationales Kooperationsprojekt des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg, der Technischen Universität München (TUM) und des Helmholtz Zentrums München mit dem Chiba Children’s Hospital und der Saitama Medical University, Japan, sowie der Medizinischen Universität Innsbruck. Literatur:
Kopajtich et al., Biallelic IARS Mutations Cause Growth Retardation with Prenatal Onset, Intellectual Disability, Muscular Hypotonia, and Infantile Hepatopathy, The American Journal of Human Genetics (2016), DOI: 10.1016/j.ajhg.2016.05.027 Staufner C et al., Recurrent acute liver failure due to NBAS deficiency: phenotypic spectrum, disease mechanisms, and therapeutic concepts. J Inherit Metab Dis. (2016), DOI: 10.1007/s10545-015-9896-7 Haack T.B. et al., Biallelic Mutations in NBAS Cause Recurrent Acute Liver Failure with Onset in Infancy. Am J Hum Genet. (2015), DOI: 10.1016/j.ajhg.2015.05.009
Das Helmholtz Zentrum München verfolgt als Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt das Ziel, personalisierte Medizin für die Diagnose, Therapie und Prävention weit verbreiteter Volkskrankheiten wie Diabetes mellitus und Lungenerkrankungen zu entwickeln. Dafür untersucht es das Zusammenwirken von Genetik, Umweltfaktoren und Lebensstil. Der Hauptsitz des Zentrums liegt in Neuherberg im Norden Münchens. Das Helmholtz Zentrum München beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter und ist Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft, der 18 naturwissenschaftlich-technische und medizinisch-biologische Forschungszentren mit rund 37.000 Beschäftigten angehören.
Die Technische Universität München (TUM) ist mit mehr als 500 Professorinnen und Professoren, rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 38.500 Studierenden eine der forschungsstärksten Technischen Universitäten Europas. Ihre Schwerpunkte sind die Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Lebenswissenschaften und Medizin, ergänzt um Wirtschafts- und Bildungswissenschaften. Die TUM handelt als unternehmerische Universität, die Talente fördert und Mehrwert für die Gesellschaft schafft. Dabei profitiert sie von starken Partnern in Wissenschaft und Wirtschaft. Weltweit ist sie mit einem Campus in Singapur sowie Verbindungsbüros in Brüssel, Kairo, Mumbai, Peking, San Francisco und São Paulo vertreten. An der TUM haben Nobelpreisträger und Erfinder wie Rudolf Diesel, Carl von Linde und Rudolf Mößbauer geforscht. 2006 und 2012 wurde sie als Exzellenzuniversität ausgezeichnet. In internationalen Rankings gehört sie regelmäßig zu den besten Universitäten Deutschlands.
Das Universitätsklinikum Heidelberg ist eines der bedeutendsten medizinischen Zentren in Deutschland; die Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg zählt zu den international renommierten biomedizinischen Forschungseinrichtungen in Europa. Gemeinsames Ziel ist die Entwicklung innovativer Diagnostik und Therapien sowie ihre rasche Umsetzung für den Patienten. Klinikum und Fakultät beschäftigen rund 12.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und engagieren sich in Ausbildung und Qualifizierung. In mehr als 50 klinischen Fachabteilungen mit ca. 1.900 Betten werden jährlich rund 66.000 Patienten voll- bzw. teilstationär und mehr als 1.000.000 mal Patienten ambulant behandelt. Das Heidelberger Curriculum Medicinale (HeiCuMed) steht an der Spitze der medizinischen Ausbildungsgänge in Deutschland. Derzeit studieren ca. 3.500 angehende Ärztinnen und Ärzte in Heidelberg. Am Institut für Humangenetik (IHG) stehen die Identifizierung und funktionelle Charakterisierung von Genen, die Krankheiten verursachen, im Mittelpunkt der Forschung. Dabei werden Genmutationen, Genvarianten und die Gen-assoziierten Signalwege untersucht. Inhaltliche Schwerpunkte bilden Endokrinopathien, Herzrhythmusstörungen, neurologische Störungen sowie Mitochondropathien. Durch die Kenntnis krankheitsverursachender Genvarianten lassen sich Konzepte für neue Therapieansätze entwickeln.